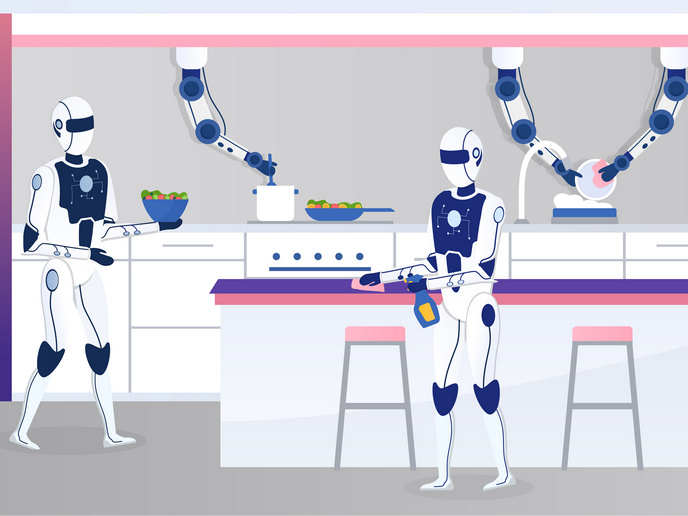Zensieren oder nicht zensieren: Ein uneindeutiger Fall: Chaucers Canterbury-Erzählungen
In der Geschichte hat es sich schon immer als schwierig erwiesen, durch die Sprache verursachte Beleidigungen vorher abzuschätzen und ihnen zuvorzukommen. Viele literarische Werke haben sich im Mittelpunkt von Debatten darüber befunden, ob ihr Inhalt zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte akzeptabel oder inakzeptabel war. Für ein besseres Verständnis darüber, welche Arten literarischer Inhalte zensiert werden und aus welchem Grund, untersuchte das Projekt Chaucer im Rahmen der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA) die Zensur und das Zelebrieren der Obszönität in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Manuskripten der Canterbury-Erzählungen. Konkret wurden in der Forschungsarbeit „sexuelle und skatologische Sprache und Inhalte“ beleuchtet, erklärt MSCA-Stipendiatin und leitende Wissenschaftlerin Mary Flannery.
Chaucers Werk unter der Lupe
Ende des 14. Jahrhunderts verfasst, sind die Canterbury-Erzählungen eines der berühmtesten und mitunter umstrittensten Werke der mittelalterlichen Literatur. Der Autor, Geoffrey Chaucer, der zuweilen als „Vater der englischen Literatur“ bezeichnet wird, ist eine Schlüsselfigur der englischen Literaturgeschichte. „Indem wir aufdecken, wie die Entwicklung seines derben Humors und seiner obszönen Sprache in den ersten Jahrhunderten nach seinem Tod im Jahr 1400 rezipiert wurde, bekommen wir eine klarere Vorstellung davon, welche Faktoren bestimmen, was in anstößigen Texten erhalten bleibt und was entfernt wird“, beobachtet Flannery. Ein wichtiges Ergebnis des Projekts ist, dass es in den 84 Manuskripten und Fragmenten der Canterbury-Erzählungen, die aus dem 15. Jahrhundert bis heute überlebt haben, unterschiedliche Reaktionen auf Chaucers Obszönität gab. „Einige Manuskripte lassen anstößige Passagen weg oder ersetzen anstößige Wörter. Andere führen berühmte Passagen, wie zum Beispiel das Ende der Erzählung des Kaufmanns [‚The Merchant’s Tale‘], wo zwei Charaktere eine sexuelle Begegnung in einem Birnbaum haben, noch detaillierter aus“, betont Flannery. In mehreren Manuskripten haben die Schreibenden besonders explizite Beschreibungen dieser Begegnung hinzugefügt. Die meisten Manuskripte zeichnen diese unanständigen Worte und humorvoll-unsittlichen Szenen jedoch einfach ohne Kommentar und mit nur geringfügigen Abweichungen auf. „Daher können wir keine pauschalen Aussagen darüber treffen, wie die Leser in dieser Zeit auf den sexuellen und skatologischen Inhalt der Canterbury-Erzählungen reagierten.“
Herausforderungen meistern
„Die größte Herausforderung bei diesem Projekt war die Frage, wie man den einzelnen Manuskript- und Druckexemplaren der Canterbury-Erzählungen gerecht werden kann und gleichzeitig den Geschichtsfaden im Großen und Ganzen nicht aus den Augen verliert“, berichtet Flannery. Das liegt daran, dass die verschiedenen Exemplare Belege unterschiedlicher Art hervorbringen was die Reaktionen der einzelnen Personen angeht, die sich mit dem Schreiben, Lesen, der Redaktion oder Publikation befasst haben. Dazu zählen auch Kunstschaffende im Falle der illustrierten Exemplare. Um diese Inkongruenz zu überwinden, verfolgte Flannery zwei parallele „Ströme“ von Publikationen: stärker fokussierte Fallstudien zu einzelnen Exemplaren in Form von Artikeln und Buchkapiteln sowie die Monografie, die das Endergebnis des Projekts bilden wird und die auch die breitgefächerte Geschichte dieses Themas über die letzten sechs Jahrhunderte nachzeichnen wird. Diese und andere Projekte sind auf der Website der Stipendiatin aufgeführt. In die Zukunft blickend, teilt Flannery mit: „Ich habe ein fünfjähriges Stipendium vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung erhalten, um die Geschichte von Chaucers Obszönität und ihrer Rezeption über die letzten 600 Jahre zu Ende zu führen.“ Das neue Projekt „Canonicity, Obscenity, and the Making of Modern Chaucer“ baut auf den Ergebnissen von Censoring Chaucer auf, indem es sich darauf konzentriert, wie Leserschaft und Publizierende auf Chaucers obszöne Sprache und Inhalte zwischen 1700 und der Gegenwart reagierten.
Schlüsselbegriffe
Censoring Chaucer, Canterbury-Erzählungen, The Canterbury Tales, Chaucers Obszönität, Literatur, Zensur, obszöne Sprache