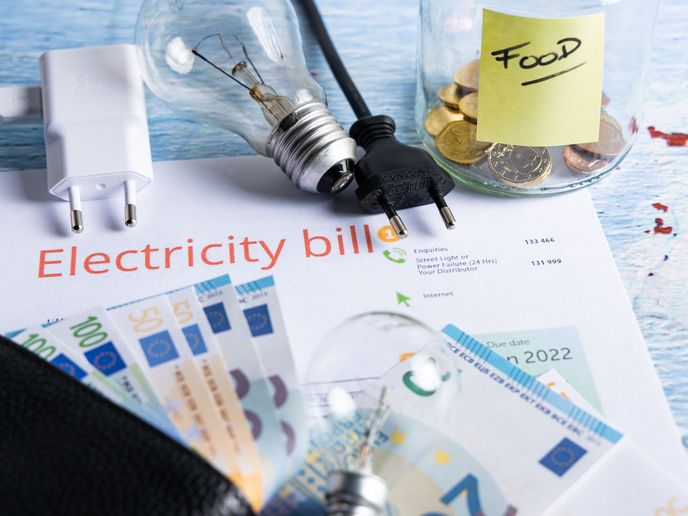Wachsamkeit der Bevölkerung als Schlüssel für ein erfolgreiches Management von Megaprojekten
Megaprojekte, die gewöhnlich umfangreiche und teure Vorhaben wie den Bau von Dämmen und Flughäfen umfassen, werden immer kontrovers betrachtet. Das liegt vor allem an dem großen politischen und wirtschaftlichen Anteil und den vielen beteiligten Interessengruppen. Kontroversen ergeben sich auch aus der Tatsache, dass diese Projekte das Potenzial haben, die Gesellschaft tiefgreifend zu verändern. Eine neue Trasse für Hochgeschwindigkeitszüge hätte zum Beispiel nicht nur einen bedeutenden wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Einfluss auf die Gemeinden, durch die sie verläuft, sondern würde auch die Reisegewohnheiten und Entscheidungen zur Lage von Häusern und Unternehmen verändern. „Auseinandersetzungen zwischen Befürwortenden sowie Gegnerinnen und Gegnern ziehen üblicherweise große Unstimmigkeiten zu grundlegenden Werten und Weltanschauungen nach sich“, sagt TENUMECA-Projektkoordinator Albert Presas i Puig von der Universität Pompeu Fabra im spanischen Barcelona. „Angesichts der starken Konkurrenz durch alternative Energiequellen und der enorm strengen und kostspieligen Sicherheitsanforderungen sind Megaprojekte im Nuklearsektor besonders anfällig für Probleme und Kontroversen.“
Konstruktive Kontroversen
Das Projekt TENUMECA, das über die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen unterstützt wurde, wurde durch die Herausforderungen angeregt, denen Megaprojekte für Kernkraft in Finnland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich gegenüberstehen. Das Projekt wollte herausfinden, wie konstruktive Kontroversen gefördert werden könnten, um das demokratische Management der jeweiligen Projekte zu verbessern. Dazu untersuchte Marie-Skłodowska-Curie-Stipendiat Markku Lehtonen von der Universität Pompeu Fabra in Barcelona die Verbindungen zwischen den verschiedenen Dimensionen von Vertrauen – vom zwischenmenschlichen Vertrauen bis hin zum Vertrauen in abstrakte Konzepte wie Demokratie, Markt und Staat. Er analysierte das Aufkommen von Organisationen mit Gegenexpertise, die Rolle der betreffenden Gemeinden bei der Überwachung von Projekten zu Atomendlagern und die Art und Weise, wie die Medien und internationale Kernkraftfachleute mit Problemen und Kontroversen rund um diese Projekte umgehen.
Misstrauische Wachsamkeit der Bevölkerung
Das Projekt stellte fest, dass Megaprojekte wie lebende Organismen sind – sie passen sich stetig an ihre Umgebung an und entwickeln sich mit ihr mit. Werden die Rahmenbedingungen nicht kommuniziert, kann es zu Schwierigkeiten kommen, wie sie jüngste Kernkraftprojekte und -technologien beim Erlangen von Legitimität und Glaubwürdigkeit ausgesetzt waren, und zwar nicht nur bei der Bevölkerung und den Interessengruppen, sondern auch innerhalb der Atomgemeinschaft. „Die Beurteilung und das Management dieser Projekte darf sich nicht nur auf die Kosten, den Zeitplan und die vordefinierten Projektspezifikationen beschränken“, erklärt Lehtonen. „Fachleute neigen dazu, Probleme auf externe Faktoren abzuwälzen, anstatt auf eine ungenügende Kontextualisierung.“ Das Projekt konnte die Bedeutung des Konzepts der „misstrauischen Wachsamkeit der Bevölkerung“ herausstellen. Vertrauen lässt sich leichter in Ländern wie Finnland und Schweden aufbauen, wo ein großes zwischenmenschliches Vertrauen, aber auch Vertrauen in Institutionen und den Staat herrscht. Ist das Vertrauen zu groß, ist die Zivilgesellschaft unter Umständen zu keiner konstruktiven Wachsamkeit fähig, die auf einem gesunden Misstrauen gegenüber den Machthabenden aufbaut. „Unsere Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung des gesellschaftlichen Kontexts, die möglichen Vorzüge von Misstrauen und die Gefahr eines zu großen Vertrauens“, sagt Lehtonen. „Sie zeigen auch, wie wichtig die Förderung einer bürgerlichen Wachsamkeit ist. Um aufrichtig und beständig zu sein, muss Vertrauen auf Misstrauen aufbauen.“ Lehtonen und Presas würden es begrüßen, wenn die Industrie und der Staat ihre Erkenntnisse in Zukunft bei der Ausübung der sozialen Verantwortung berücksichtigen würden. Internationale Begutachtungsverfahren, wie die, die von der OECD durchgeführt werden, zeigen, wie Vertrauen und Misstrauen Hand in Hand gehen können, und fördern gesellschaftlich fundiertere Entscheidungs- und Managementpraktiken. Presas interessiert sich dafür, wie Staaten mit der andauernden COVID-19-Pandemie umgegangen sind. „Die COVID-Krise hat Vertrauensfragen direkt in den Mittelpunkt gerückt“, merkt er an. „Unsere Forschung in der nahen Zukunft wird den Umgang mit COVID aus Sicht eines konstruktiven Misstrauens untersuchen.“
Schlüsselbegriffe
TENUMECA, Megaprojekte, nuklear, Demokratie, gesellschaftlich, Vertrauen, Wachsamkeit der Bevölkerung, Management