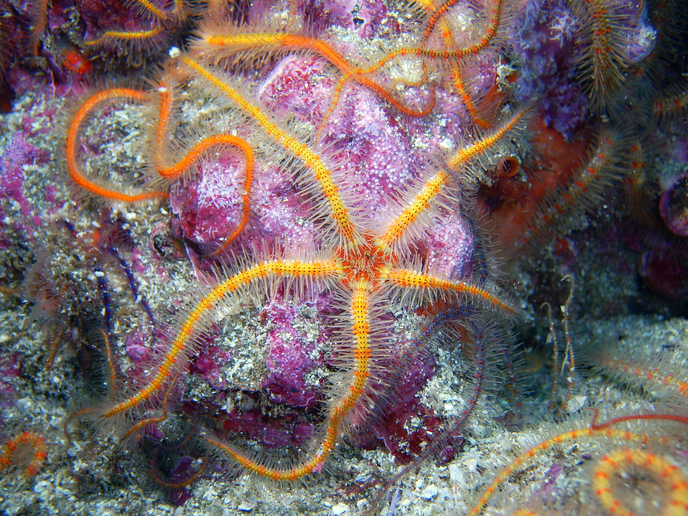Wie Zahnwale Schall „sehen“ können
Zahnwale sind eine außergewöhnliche Gruppe von Meeressäugetieren, die sich über Millionen von Jahren weiterentwickelt haben. Besonders bemerkenswert ist ihre Fähigkeit, im tiefen dunklen Ozean „sehen“ zu können. Da sie sich nicht auf ihr Sehvermögen verlassen können, haben Wale, Delfine und Tümmler, allesamt Cetaceen, gelernt, sehr genau zu hören und sind in der Lage, das Echo zu orten. Dieser unglaubliche sechste Sinn der Echoortung ist eine notwendige Anpassung für Zahnwale (Odontoceti), welche die artenreichste Abstammungslinie der Meeressäugetiere darstellt. In der Tat ist der sechste Sinn der Katalysator für ihren Evolutionserfolg. Die Wale nutzen diesen scharfen Gehörsinn, um ihre Umgebung zu „sehen“, Raubtiere zu sichten, Nahrung zu finden und zu kommunizieren. Während die Forschung, die sich mit dem Gehör der Zahnwale befasst, bisher vollständig auf physiologische Experimente und die Erkennung der Hörbahn ausgerichtet war, konzentrierte sich das Projekt ECHO auf die Cochlea.
3D-Modelle der Cochlea
Echoortung ist eine Form des biologischen Sonars. Dabei wird hochfrequenter Schall verwendet, welcher in der Stirn erzeugt und schließlich von der Cochlea detektiert wird. Mithilfe modernster Scan- und Visualisierungstechniken sowie quantitativer Analysemethoden wie der geometrischen 3D-Morphometrie konnten die Forschenden die Unterschiede in der Morphologie der Cochlea des Zahnwals erkennen. Das Hauptziel des ECHO-Projekts war die Erforschung der Vielfalt der Zahnwal-Cochleae. „Das haben wir mit Sicherheit erreicht, da wir jetzt 3D-Cochlea-Modelle von 95 % der lebenden Zahnwal-Gattungen sowie der Vertreter von etwa 20 ausgestorbenen Zahnwal-Familien besitzen. Dies stellt einen gewaltigen Sprung vorwärts in unserer Stichprobengröße dar, die vor dem Beginn dieses Projekts um ein Vielfaches kleiner war“, erklärt Travis Park, Projektkoordinator und promovierter wissenschaftlicher Mitarbeiter am Natural History Museum in London. Das Projekt war auch darauf ausgerichtet, die konvergente Entwicklung der Echoortungsfähigkeiten von Zahnwalen zu erforschen. „Ursprünglich sollte dieses Forschungsvorhaben nur auf Flussdelfine abzielen, aber wir weiteten die Studie schließlich aus, um alle lebenden Gruppen unter den Zahnwalen zu betrachten. Dies führte zu einer umfassenderen, besseren Studie“, merkt Park an. Aus der Studie zur konvergenten Entwicklung konnte das ECHO-Team kritische Daten zusammenfügen und einige bemerkenswerte Erkenntnisse gewinnen. Zum Beispiel ergaben die Daten, dass die extremen akustischen Bedingungen im tiefen Ozean wahrscheinlich die Form der Cochlea einschränken, wodurch die Morphologie der Cochlea bei Pottwalen und Schnabelwalen konvergiert. „Im weiteren Sinne war das Hauptergebnis, dass die Echoortungsfähigkeit an den Lebensraum bzw. die ökologische Nische gebunden ist, in der das Tier lebt. Dies ist interessant und im Einklang mit anderen Aspekten der Anatomie und dem Gehör, z. B. Schädel und Unterkiefer, die wir bei Zahnwalen gefunden haben. Es ist schön zu sehen, dass die Ergebnisse von ECHO sich in das Gesamtbild einfügen“, stellt Park klar.
Sechs Aufsätze, ein Buchkapitel und mehr
Dank der enormen Datenmenge, die während des Projekts gesammelt wurde, kann Park noch weiter aus den Forschungsergebnissen schöpfen. Bislang wurden sechs Aufsätze veröffentlicht und drei befinden sich in Bearbeitung. Es entstand auch ein Buchkapitel. „Es war also insgesamt eine sehr produktive Zeit. Für die Zukunft plane ich, den Datensatz nach Möglichkeit zu ergänzen und die Fähigkeiten und methodischen Ansätze zu nutzen, um die Evolution der Meeressäugetiere im weiteren Sinne zu erforschen, anstatt mich nur auf das Hören zu konzentrieren. Schließlich möchte ich noch eine weitere Arbeit veröffentlichen, die in direktem Zusammenhang mit ECHO steht, und ich hoffe, dies noch in diesem Jahr tun zu können.“
Schlüsselbegriffe
ECHO, Zahnwal, Cochlea, Echoortung, Gehör, Meeressäugetier, Odontoceti