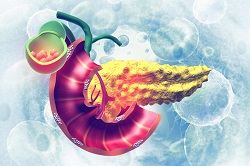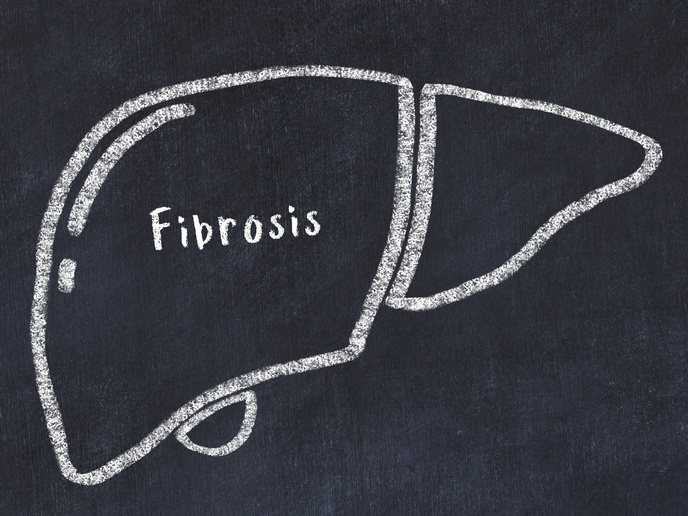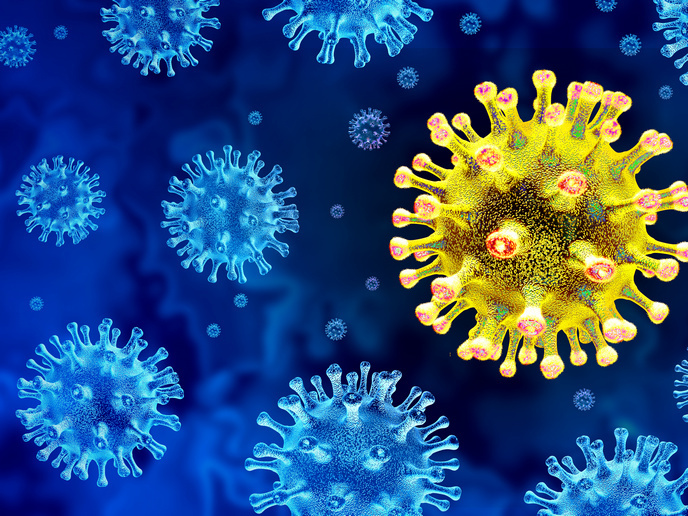Neue Biomaterialien lassen mit Gewebe-Engineering Langerhanssche Inseln aus einzelnen Zellen entstehen
Die Perspektive einer lebenslangen Medikamentenverabreichung oder ewiger Insulininfusionen ist, gelinde gesagt, demoralisierend. Noch schlimmer ist es für jene Diabetiker, die nicht auf die Verabreichung von Insulin ansprechen oder keine Symptome der Hypoglykämie aufweisen: Ihnen bleibt die Wahl zwischen der Transplantation eines Organs oder von Inselzellen der Bauchspeicheldrüse, wobei es in beiden Fällen an Spendern mangelt und die Lebenserwartung verkürzt ist. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Hoffnung gibt. Die Inselzelltransplantation ist weitgehend als die am besten geeignete Alternative zur Transplantation des gesamten Organs anerkannt, und sollte sie noch besser gelingen, so könnte sie eines Tages für viele Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt das Verfahren der Wahl darstellen. Wie es Professor Matteo Santin, Direktor des Centre for Regenerative Medicine and Devices (CRMD) an der University of Brighton, erklärt, leidet die gängige Inselzelltransplantationsmethode unter bedeutenden Einschränkungen: Mangel an verfügbaren Spendern, unzuverlässiger Selektionsprozess, unsicherer Transport und starke Immun-/Wirtsreaktion auf die Spenderinseln. Um genau diese Grenzen zu überwinden, begann Professor Santin im Oktober 2013 mit der Forschung an NEXT. Dabei handelt es sich um einen neuen Ansatz zur biotechnologischen Inselzelltransplantation unter Einsatz von Nanotechnologie. „Das NEXT-Projekt ist das Resultat der interdisziplinären Arbeit von Klinikern, Materialwissenschaftlern und Biotechnologen, in der die allerneuesten Erkenntnisse über biomimetische Nanomaterialien ausgenutzt werden“, erläutert er. Die am CRMD entwickelten Biomaterialien des Projekts stellen einen der wichtigsten Durchbrüche dar: Sie können die Bildung von Pseudo-Inselzellen durch Zusammenschluss von Pankreas-Betazellen und vaskulären Endothelzellen steuern. In vorhergehenden Ansätzen wurden Biomaterialien einzig und allein dazu verwendet, um isolierte Pankreasinseln einzukapseln. Daraus erwuchs ein begrenzter Schutz der Inseln vor der Wirtsreaktion und eine eher mangelhafte Integration in das umliegende Wirtsgewebe. NEXT löst nun beide Probleme gleichzeitig. „Anders als die mit anderen Methoden gebildeten ungeordneten Zellaggregate lässt unser Biomaterial den Biochip auf hyperglykämische Reize mit einer gesteigerten Insulinproduktion reagieren. Außerdem bietet es einen Ankerpunkt für die Kopplung des Biochips mit immunsuppressiven Proteinen“, erläutert Professor Santin. Dank einer derartigen Kopplung können spezifische biochemische Reaktionswege der Immun-/Wirtsreaktion, die bei der gängigen Behandlung zum Tod der Langerhansschen Insel führen würden, blockiert werden, womit der Einsatz von Immunsuppressiva vermieden werden kann, von denen bekannt ist, dass sie unerwünschte Nebenwirkungen für den Patienten haben. Zunächst verfolgte das Projektteam das Ziel, ein immunsuppressives Peptid direkt in das zu erforschende Biomaterial zu integrieren. Da die Resultate eher unbefriedigend ausfielen, stellte man stattdessen ein rekombinantes Protein her, das jedoch wegen seiner relativ großen Größe nicht zur Einbindung in den Biochip geeignet ist. Professor Santin weist darauf hin, dass das Protein noch auf industriell realisierbare Mengen hochskaliert werden muss, und dass das Verfahren anhand speziell dafür vorgesehener In-vivo-Modelle optimiert wird. „Bei der Optimierung muss man Größe und Anzahl der Biochips herausfinden, die optimal für eine Umkehrung der Diabetesstörungen bei den ausgewählten Tiermodellen geeignet sind. Und sie muss auf xenogenetische Protokolle erweitert werden, um nachzuweisen, dass die Technik funktionieren kann, wenn aus anderen Tierarten erzeugte immungeschützte Biochips transplantiert werden. Aus zeitlichen Gründen konnten die Partner dieses Ziel nicht erreichen“, sagt er. Zwischenzeitlich konnten die Partner neuartige Methoden und Ausstattung entwickeln, welche die erfolgreiche klinische Transplantation der aus Gewebezüchtungen erzeugten Biochips ermöglichen. Dazu zählen ein In-vitro-Modell der Fibrose von AvantiCells Science zum Test von Pankreaszellinseln auf deren Tendenz, in einer unerwünschten faserigen Kapsel eingekapselt zu werden, ein batteriebetriebener Bioreaktor von Cellon, der problemlos in Rettungsfahrzeugen untergebracht werden kann, ein umfangreicher Satz rekombinanter immunsuppressiver Proteine sowie ein neuartiger Baukasten zur modularen DNA-Assemblierung, der jetzt von Explora als Doulix vermarktet wird. Läuft alles wie geplant, könnte mit der NEXT-Technologie außerdem das gängige klinische Vorgehen bei der Transplantation von Langerhansschen Inseln auf die Nutzung von Tiergeweben und nicht nur von Spenderpräparaten ausgeweitet werden. Die Technologie wird die Einrichtung von Zellbanken ermöglichen, die der Herstellung von immunologisch geschützten Biochips dienen werden. Auf diese Weise wird man das Problem der mangelnden Spender und der Immunreaktionen nach Transplantation lösen können.
Schlüsselbegriffe
NEXT, Nanomaterialien, Diabetes, Bauchspeicheldrüse, Pankreas, Pankreasinsel, Langerhanssche Insel, Insulin, Transplantation, Biomaterialien, Biochip, Protein, in vivo, Immunreaktion