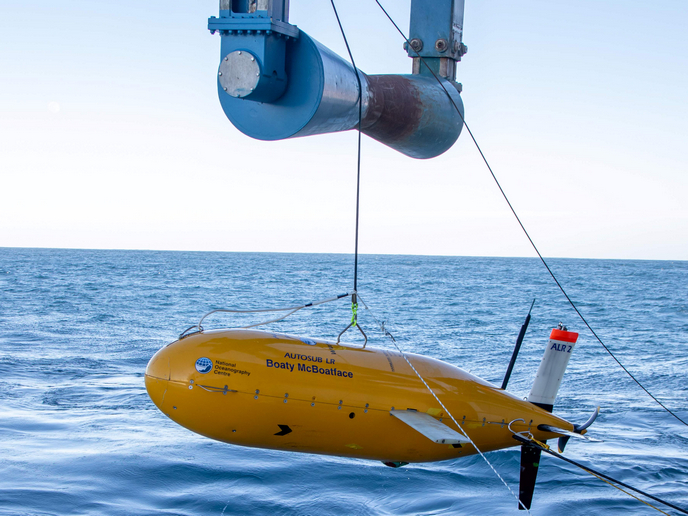Woraus ergibt sich eine erfolgreiche „Invasion“?
Laut dem Bericht über invasive gebietsfremde Arten 2023 des UN-Umweltprogramms sind menschliche Aktivitäten für die Einführung von mehr als 37 000 gebietsfremden Arten in nicht einheimischen Regionen verantwortlich. Dadurch haben sich nicht nur die Ökosysteme drastisch verändert, sondern auch die Kosten für die Weltwirtschaft betragen jährlich mehr als 400 Milliarden EUR. Es ist unerlässlich, dass wir die Anpassungsmechanismen verstehen, die dazu führen, dass eine eingeführte Art zu einem erfolgreichen „Eindringling“ wird oder in diesem Prozess untergeht. Im Rahmen des über die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen unterstützten Projekts INVASOMICS werden Feldarbeit und Laborexperimente kombiniert, um die Rolle der adaptiven Plastizität für das Überleben und Gedeihen invasiver Arten zu untersuchen.
Präadaptation und Transportwahl bei invasiven Arten
„Überlebende von durch den Menschen verursachten Belastungen, wie z. B. sehr hohe Stickstoffwerte (Eutrophierung) in ihrer ursprünglichen Umgebung oder sehr raue Transportbedingungen, einschließlich Hypoxie und/oder Ausscheidungsprodukte, haben möglicherweise einen einzigartigen Vorteil in neuen Regionen mit ähnlichen Bedingungen“, so INVASOMICS-Koordinator Jonas Jourdan und der Stipendiat der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen Oriol Cano Rocabayera von der Goethe-Universität Frankfurt. INVASOMICS hat zwei Modellsysteme ausgewählt, um diese Präadaptation und Transportwahl zu analysieren. Das erste ist der Östliche Moskitofisch (Gambusia holbrooki). Die wenigen überlebenden der 1921 zur Bekämpfung von Malaria von North Carolina nach Spanien verschifften Exemplare wurden in Extremadura (Spanien) ausgesetzt, wo sie die angrenzenden Gewässer besiedelten. Invasive Moskitofische, die ursprünglich aus den USA stammen, sind heute in Gewässern von Europa über Palästina bis nach Russland zu finden. Es wurden neun Moskitofisch-Populationen aus drei Gebieten untersucht: invasive (Extremadura), einheimische (Florida) sowie die einheimischen Verwandten der europäischen invasiven Populationen (North Carolina). Das zweite Modellsystem von INVASOMICS waren die Gammaridea (amphipode Krebstiere). Sie gelangen häufig mit dem Ballastwasser von Schiffen in neue Gebiete und verdrängen einheimische Populationen, um sich erfolgreich zu etablieren. Drei Gammaridea-Arten mit unterschiedlichem Erhaltungszustand aus dem Maineinzugsgebiet (Hessen, Deutschland) wurden in die Studie aufgenommen, um artspezifisch unterschiedliche Toleranzen gegenüber Nitritbelastungen beleuchten zu können.
Natürliches „Labor“ und kontrollierte Laborexperimente
Die in freier Wildbahn gefangenen Moskitofische und Gammaridea wurden nicht tödlichen, realistischen Mengen von Nitrit ausgesetzt, einer hochgiftigen, natürlich vorkommenden Verbindung des Stickstoffkreislaufs, deren Werte aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitäten enorm gestiegen sind. „INVASOMICS kombinierte den Realismus der Verwendung von in freier Wildbahn gefangenen Tieren mit den Vorteilen von Hypothesentests in kontrollierten Laborexperimenten. Es war aufregend, die geeigneten Standorte zu finden, die lebenden Wildtiere zu sammeln und die Expositionstests durchzuführen sowie fortschrittliche Analyseverfahren wie RNA-Sequenzierung und Bewegungsverfolgung zu nutzen“, erklärt Cano Rocabayera.
Profilerstellung invasiver Arten ist sehr komplex
Ob invasive Moskitofische toleranter gegenüber Eutrophierung sind, konnte nur schwer bestätigt werden, da alle neun Moskitofisch-Populationen ähnliche subletale Auswirkungen aufweisen. Das Leben in einer verschmutzten Umgebung war allerdings ein Unterscheidungsmerkmal. „Drei ausgewählte Gene wurden in Fischen aus verschmutzten und sauberen Gebieten unterschiedlich stark exprimiert, was möglicherweise auf eine Anpassung an die chronische Stickstoffverschmutzung in jüngster Zeit hinweist“, so Cano Rocabayera. „Faktoren wie die kleineren, aber zahlreicheren Eier und Embryonen in Vorläufer- und invasiven Populationen könnten ebenfalls eine schnelle Besiedlung eines neu eroberten Lebensraums begünstigen“, fügt er hinzu. Bei den Gammaridea sieht es jedoch anders aus. Die nicht einheimische Gammaride Gammarus roeselii war sehr tolerant gegenüber der Stickstoffverschmutzung: Dies ist der erste empirische Beweis dafür, dass die höhere Toleranz nicht einheimischer Arten die Besiedlung begünstigen kann. Außerdem war die Art, die normalerweise in abgelegeneren Gegenden lebt, besonders gefährdet. „Das beunruhigt und verdeutlicht uns, in welchen Gewässern vorrangig Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten“, betont Jourdan. „Wir leben in einer Zeit, in der sich die Umweltbelastungen rasant verändern, aber wir wissen nur wenig über deren Wechselwirkungen mit den Ökosystemen. Die jüngste Differenzierung zwischen Populationen, die unter verschiedenem Eutrophierungsdruck stehen, spielt eindeutig eine entscheidende Rolle für die Reaktion eines Organismus. Unsere Modellsysteme können uns helfen, unsere Ökosysteme zu verstehen und zu schützen“, fasst Jourdan zusammen.
Schlüsselbegriffe
INVASOMICS, Moskitofisch, invasive Arten, Ökosysteme, Stickstoffverschmutzung, gebietsfremde Arten, Eutrophierung, Gammaridae, Gammaridea, adaptive Plastizität, Präadaptation, Transportwahl