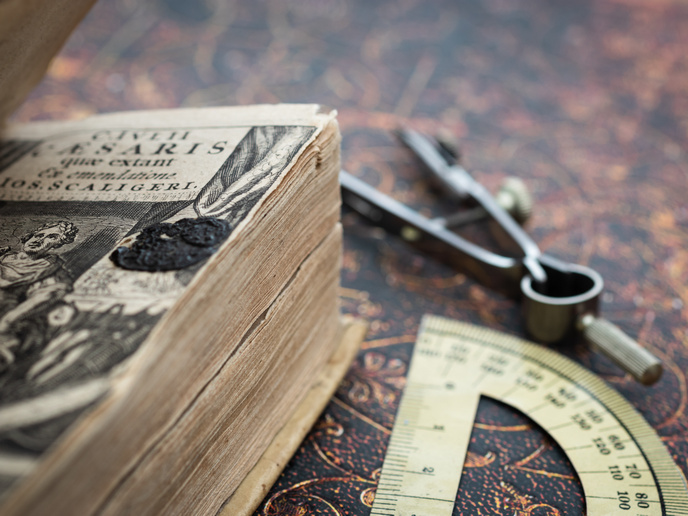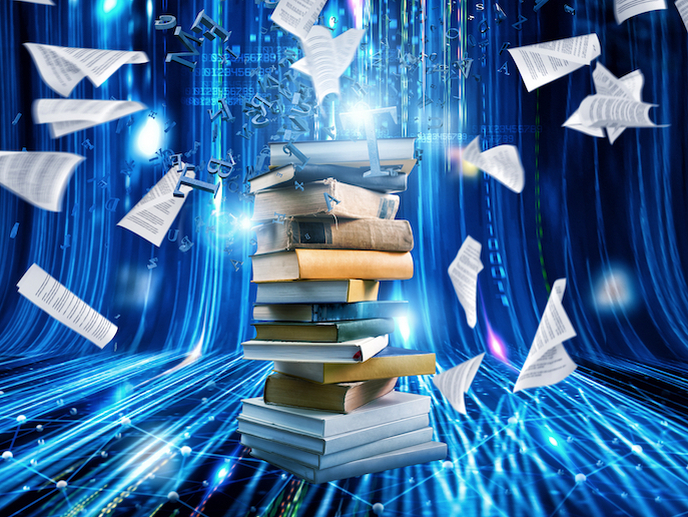Was die wissenschaftliche Revolution Latein schuldig ist
Die Wissenschaft, wie wir sie heute kennen, entstand zwischen dem späten 15. und dem 18. Jahrhundert aus dem Studium der Natur. Als Verkehrssprache der damaligen Zeit war Latein für diese Entwicklung extrem wichtig. Doch während der Umfang und die Bedeutung der Rolle der lateinischen Sprache seit langem bekannt sind, blieben viele konkrete Details im Dunkeln. Nachdem eine Datenbank mit rund 1 000 wissenschaftlichen Texten in lateinischer Sprache eingerichtet wurde, hat das Team vom Europäischen Forschungsrat finanzierte Projekt NOSCEMUS eine Monografie erstellt, in der ein Überblick über das Gebiet gegeben wird. Sie soll demnächst bei Oxford University Press erscheinen. Außerdem wurden vier weitere Monografien erstellt, in denen die wichtigsten Funktionen der Literatur analysiert werden: die Benennung neuer Objekte und Begriffe, ihre Beschreibung und Erläuterung, Stellungnahmen zu bestimmten Ansichten und die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten. „Dieser erste Überblick über die frühneuzeitliche wissenschaftliche Literatur in lateinischer Sprache bietet einen guten Ausgangspunkt für Forschende, die ihr Verständnis für bestimmte Bereiche verfeinern oder vertiefen wollen“, sagt Martin Korenjak, Koordinator des Projekts NOSCEMUS.
Wunder der Digitalisierung, Leiden der Kategorisierung
Während Massendigitalisierungsprogramme wie Google Books eine wertvolle Forschungsmöglichkeit boten – die Anzahl der einschlägigen Texte lag im sechsstellig Bereich –, versuchte Korenjak, Chronologie, wissenschaftliche Fachgebiete und literarische Gattungen darzustellen, anstatt auf Vollständigkeit zu achten. Die Chronologie erwies sich als relativ einfach – der Zeitraum wurde nach Jahrhunderten eingeteilt, von der Erfindung des Buchdrucks bis zum Niedergang des Lateinischen –, aber der Rest war kniffliger. Die Wissenschaft hat sich im Laufe der Zeit verändert, daher lässt sich die Landschaft der frühneuzeitlichen Wissenschaft nicht einfach auf die Gegenwart übertragen. Korenjak verwendete in der Datenbank somit eine Mischung aus frühneuzeitlichen (z. B. Alchemie, Astrologie) und modernen Kategorien (z. B. Physik). Inzwischen wurden die Texte in 20 Hauptgattungen eingeteilt, wofür der Wegfall von Nebengattungen und die Erfindung einiger neuer Gattungen erforderlich waren. Um die lateinischen Texte in der Datenbank zu transkribieren, entwickelte Korenjaks Teammitglied Stefan Zathammer eine Version des Tools zur optischen Zeichenerkennung „Transkribus“. Es wird inzwischen auch von anderen Forschenden genutzt und kann auch Drucke in den verschiedenen Mundarten und Schriftarten der Zeit verarbeiten. Ein wesentliches Ergebnis von NOSCEMUS war, dass das Bild der in der Latinistik Beschäftigten von der frühneuzeitlichen lateinischen Literatur zu sehr von anderen Arten von Schriften, insbesondere Belles Lettres, dominiert wurde, da wissenschaftliche und technische Texte in der Regel nicht in ihr Fachgebiet fallen. Inzwischen tendieren Personen, die sich mit Wissenschaftsgeschichte auseinandersetzen, dazu, die lateinisch geprägten Aspekte von akademischen Dissertationen bis hin zur botanischen Tradition zu vernachlässigen. „Unsere Analyse hat ergeben, dass beide Gruppen interessante Aspekte ihrer Fachgebiete vernachlässigt haben, während sie gleichzeitig Gefahr liefen, sachliche Fehler zu begehen und sogar ihre Themen zu verfälschen. So sind zum Beispiel Menschen, die in der Volkssprache geschrieben haben, wie Galileo Galilei, zu Helden der Wissenschaft geworden, während andere, die ebenso wichtig waren, aber in lateinischer Sprache veröffentlicht hatten, wie Galileis brillanter Gegenspieler Christoph Scheiner, heute weitgehend in Vergessenheit geraten“, stellt Korenjak fest.
Erkenntnisse für die Gegenwart
Wenn man die Texte unter dem Blickwinkel der antiken Rhetorik liest, die für die Ausbildung der lateinischen Autorenschaft von wesentlicher Bedeutung war, wird laut Korenjak ihre Kommunikationsfähigkeit deutlich, da sie für eine gebildete Leserschaft jenseits der wissenschaftlichen Gemeinschaft schrieben. „Wir können viel von der Art und Weise lernen, wie diese Autorinnen und Autoren überzeugende Argumente aufbauen. Dies ist besonders relevant für unsere eigene Zeit, die oft von Misstrauen oder Missachtung der Wissenschaft geprägt ist, wie die Pandemie verdeutlicht hat“, fügt Korenjak hinzu. Die Textanalyse von NOSCEMUS legt außerdem nahe, dass sich das Studium der Natur während des größten Teils der frühen Neuzeit in enger Wechselwirkung mit der Entwicklung des Humanismus herausbildete. „Da die Wissenschaft neben Theologie, Recht, Philosophie, Geschichte und Philologie nur ein Bereich des frühneuzeitlichen Lernens war, würden wir von ähnlichen Übersichten über diese Bereiche profitieren“, sagt Korenjak von der Universität Innsbruck, an der das Projekt angesiedelt war.
Schlüsselbegriffe
NOSCEMUS, Latein, frühe moderne Wissenschaft, Text, Volkssprache, optische Zeichenerkennung, Monografie, Literatur, Humanismus, Datenbank