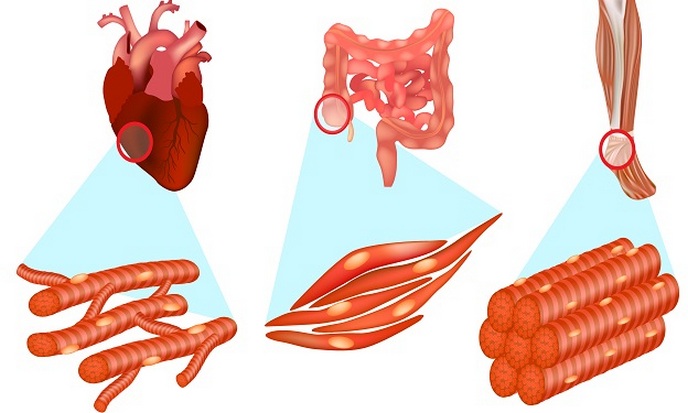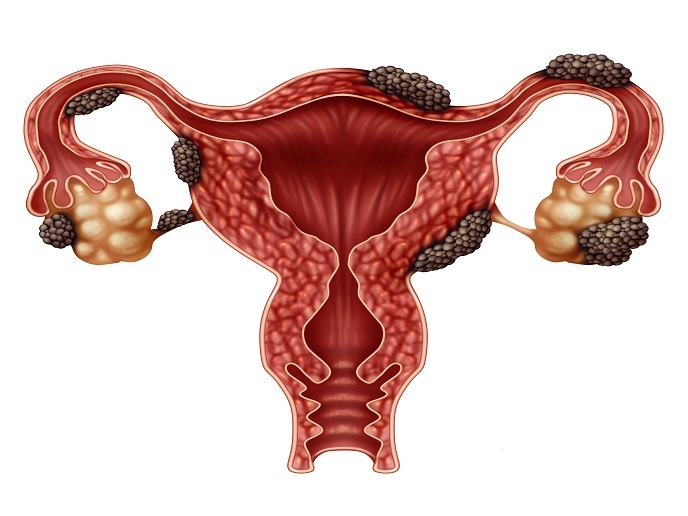Pflanzliche Augentropfen gegen Sehverlust
Infektiöse Keratitis kann durch verschiedenste Mikroorganismen wie Bakterien, Viren oder Pilze verursacht werden. Ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht zudem beim Tragen von Kontaktlinsen sowie Entzündungen in Folge operativer Eingriffe oder Schädigungen der Netzhaut.
Pflanzliches Antibiotikum mit antimikrobiellen Eigenschaften
Die konventionelle Therapie bei infektiöser Keratitis ist die topische Anwendung von Antibiotika, gegen die sich allerdings Resistenzen entwickeln können, die den Behandlungserfolg begrenzen. Eine Alternative zu Antibiotika ist die Vernetzung von Kollagenfasern im Hornhautgewebe. Im Zuge dessen werden Pathogene durch Riboflavin und ultraviolettes Licht abgetötet, was die Gewebezerstörung minimiert. Durch das UV-Licht können allerdings auch Schäden am Auge entstehen. Als Therapieansatz machte sich das EU-finanzierte Projekt CORLINK die vernetzenden Eigenschaften eines pflanzlichen Wirkstoffs zunutze: Genipin wird aus Gardenia jasminoides gewonnen und zeichnet sich durch antimikrobielle Eigenschaften und minimale Toxizität aus, sodass auf UV-Licht verzichtet werden kann. CORLINK wurde über die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen finanziert und testete die antimikrobielle Wirkung von Genipin gegen grampositive (Staphylococcus aureus) und gramnegative (Pseudomonas aeruginosa) Bakterien sowie Pilze (Candida sp. und Fusarium sp.). „Die antimikrobiellen Eigenschaften von Genipin hemmen das Pathogenwachstum, was wir an einem Ex-vivo-Hornhautmodell für infektiöse Keratitis demonstrierten“, umreißt Marie-Skłodowska-Curie-Forschungsstipendiatin Elena Koudouna. Bereits bei einmaliger Behandlung der Hornhäute von Ex-vivo-Modellen, die mit Staphylococcus aureus und Pseudomonas aeruginosa infiziert waren, reduzierte Genipin signifikant das Bakterienwachstum. Am In-vivo-Modell für infektiöse Hornhautkeratitis wurde zudem bestätigt, dass Genipin die Immunantwort des Wirts auf die Infektion verstärkt, was ein wichtiger therapeutischer Faktor ist. Worauf die antimikrobielle Wirkung von Genipin beruht, ist allerdings noch nicht ganz geklärt. Die wahrscheinlichste These ist, dass die Vernetzung diverser Proteine auf der Oberfläche von Bakterien lebenswichtige bakterielle Prozesse wie Zellteilung und Wachstum hemmt. Vermutet wird aber auch, dass die Wechselwirkung zwischen Genipin und intrazellulären Enzymen den bakteriellen Stoffwechsel stört. Schließlich verzögert Genipin offenbar zerstörerische Prozesse im Gewebe, was Ex-vivo-Versuche mit menschlicher Hornhaut zeigten.
Genipin in Form von Augentropfen
Schwerpunkt von CORLINK waren wirksamere Therapien gegen infektiöse Keratitis, insbesondere im Fall schwerer, unkontrollierbarer Verläufe, bei denen herkömmliche oder alternative Behandlungen versagen. Das Projekt demonstrierte die vielversprechenden Eigenschaften von Genipin gegen bakterielle Keratitis und dessen Eignung als neue klinische Strategie für das Management und die Behandlung infektiöser Hornhautkeratitis. „Genipin in Form von Augentropfen hätte enorme Vorteile gegenüber herkömmlichen Ansätzen, da keine Medizintechnik benötigt wird, was ein Kostenfaktor ist und so die Behandlung vor allem in Entwicklungsländern mit hoher Inzidenz deutlich vereinfachen dürfte“, betont Koudouna. In pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Studien soll nun die Dosierung und topische Anwendung von Genipin optimiert werden. Wegen seiner vernetzenden und entzündungshemmenden Eigenschaften wird Genipin als möglicher eigenständiger oder adjuvanter Wirkstoff für das Management und die Behandlung anderer Augenerkrankungen weiter erforscht. Schließlich könnte sich Genipin zur Behandlung von Hautkrankheiten, Diabetes oder Druckgeschwüren eignen, da auch hier entzündliche Prozesse, Kollagenlyse und Gewebezerstörung eine Rolle spielen.
Schlüsselbegriffe
CORLINK, Genipin, infektiöse Keratitis, Vernetzung, Augentropfen, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa