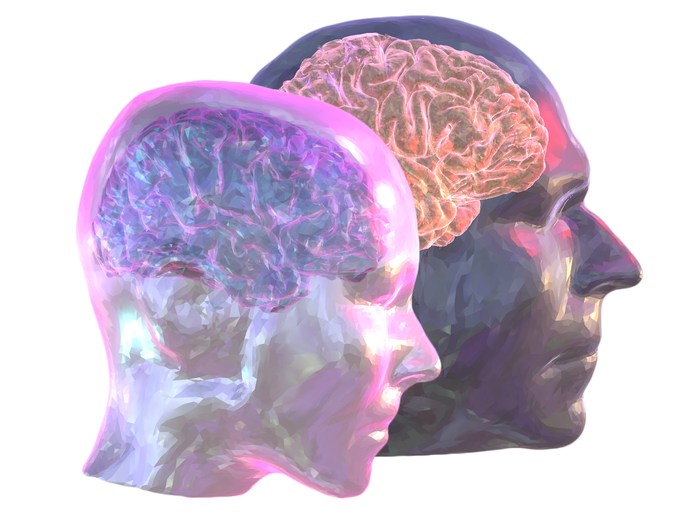Simulationen mit virtuellem Gehirn zeigen die Ursachen für Störungen
Es liegt eine gewisse kognitive Ironie darin: gerade die Komplexität des menschlichen Gehirns macht es so schwer, allein mit Gedanken Theorien über seine Mechanismen aufzustellen. Doch Computermodelle können die Konsequenzen der Theorien simulieren und dabei Probleme ausmachen sowie neue Theorien für neurowissenschaftliche Tests formulieren. Im Rahmen des Human Brain Project (HBP) versucht man, mit Hilfe von großskaligen Hirnsimulationen, und insbesondere mit dem dazugehörigen „virtuellen Gehirn“, die Entstehung sogenannter Ruhezustandsnetzwerke zu verstehen. Elektroenzephalografie (EEG) und Magnetresonanztomografie (MRT) zeigen, dass Gehirne auch dann aktiv sind, wenn sie gerade nicht mit spezifischen Aktivitäten beschäftigt sind. Gehirnsimulationen erklären diese rhythmisch auftretenden Netzwerke damit, dass sie spontan entstehen, wenn große Gruppen von Nervenzellen über die weiße Substanz des Gehirns interagieren. Suche nach erkennbaren Mustern Im Durchschnitt besteht ein Gehirn aus etwa 86 Milliarden Nervenzellen und 1 'Billiarde Verknüpfungen zwischen ihnen. Nervenzellen und Verknüpfungen bestehen wiederum aus noch kleineren Elementen, wie zum Beispiel Ionenkanälen und Dornfortsätzen, die eine Vielzahl an funktionellen Eigenschaften haben. Wollte man das Gehirn bis auf diese Ebene hinab simulieren, müssten sämtliche subtilen Eigenschaften dieser Komponenten gemessen werden. Doch die Rechenleistung der Computer ist noch zu begrenzt, um diese Berechnungen in einer praktikablen Zeitspanne durchzuführen. Auf der Brain Simulation Platform (BSP) des HBP arbeiten Teams mit Simulatoren auf verschiedenen Abstraktionsniveaus – von der Modellierung kleinerer Mengen bis zu hoher Detailgenauigkeit oder Simulationen der Gehirndynamik, die zwar eher grobkörnig sind, aber dennoch das gesamte Gehirn abbilden. Zu den letztgenannten gehört „The Virtual Brain“: „Wir versuchen nicht, das Gehirn präzise zu simulieren, sondern wir wollen vielmehr die großen Muster finden, die sich aus der Interaktion all dieser Elemente ergeben, wie bei einem Vogelschwarm“, sagt Prof. Petra Ritter, die die Arbeiten im Virtual Brain Project leitet und mit detaillierten Simulatoren auf der BSP verknüpft. Zuerst teilen die Forscher das Gehirn in Bereiche auf und formulieren dann Theorien, die sich mit Computermodellen testen lassen. Da viele Details noch unbekannt sind oder nur vage spezifiziert werden können, bilden sie das Gehirn mit EEG und fMRI ab, um die Modelle enger einzugrenzen. Mit diesen Simulationen kann das Team dann die Vernetzung zwischen einzelnen Gehirnregionen abschätzen. Daraus ergeben sich die sogenannten Konnektome (Stärke der Interaktion zwischen verschiedenen Hirnregionen), aus denen sich die Hirnaktivität genau vorhersagen lässt. „Uns interessieren die komplexesten kognitiven Funktionen wie Intelligenz, Entscheidungen, Gedächtnis und Lernen, denn darin wollen wir die Gründe für Beeinträchtigungen finden und Verbesserungsstrategien ausarbeiten“, so Prof. Ritter. Bisher hat das Projekt unter anderem neue Erkenntnisse über die Genesung nach einem Schlaganfall, die Vorhersage und Charakterisierung von epileptischen Anfällen, das Fortschreiten von Alzheimer sowie funktionsbeeinträchtigende Folgen von Hirntumoren gewonnen. Das „Virtual Brain“ steht als quelloffene Software kostenlos zum Download zur Verfügung und darf sogar verändert werden. Hoffnung auf den „virtuellen Menschen“ Neurodegenerative Erkrankungen sind eines der drängendsten Probleme moderner Gesellschaften. Abgesehen von der Belastung für den einzelnen Betroffenen ist bis zum Jahr 2030 bei prognostizierten 14 Millionen Demenzpatienten in Europa mit Kosten von mehr als 250 Mrd. EUR zu rechnen. Außerdem ist heute einer von sechs Europäern von psychischen Erkrankungen wie der bipolaren Störung, Schizophrenie, Depression, Angststörungen, PTBS, ADHS oder Alkohol- und Drogensucht betroffen, und der Prozentsatz steigt. Die Kosten für die Behandlung, soziale Absicherung und weniger Erwerbsarbeit/geringere Produktivität liegen bei 620 Mrd. EUR im Jahr. Gängige Behandlungsmethoden für diese Erkrankungen greifen meist auf Medikamente zurück, die die Symptome unterdrücken, statt die Krankheit zu heilen. Die zugrundeliegenden Mechanismen dieser Störungen sind zwar noch immer unklar, doch Ergebnisse deuten immer häufiger auf komplexe systematische physiologische Zusammenhänge hin, die sich allein mit experimentellen Methoden nur schwer untersuchen lassen. „Mit Simulationen des gesamten Gehirns, und in Zukunft auch des gesamten Körpers, werden wir das ganze System Mensch besser verstehen. Mit ‚virtuellen Menschen‘ könnten wir individuelle Interventionen entwickeln, die auf eine Kombination genetischer, metabolischer und neuronaler Faktoren abzielen, die für Störungen des Gehirns verantwortlich sind“, fasst Prof. Ritter zusammen.
Länder
Schweiz