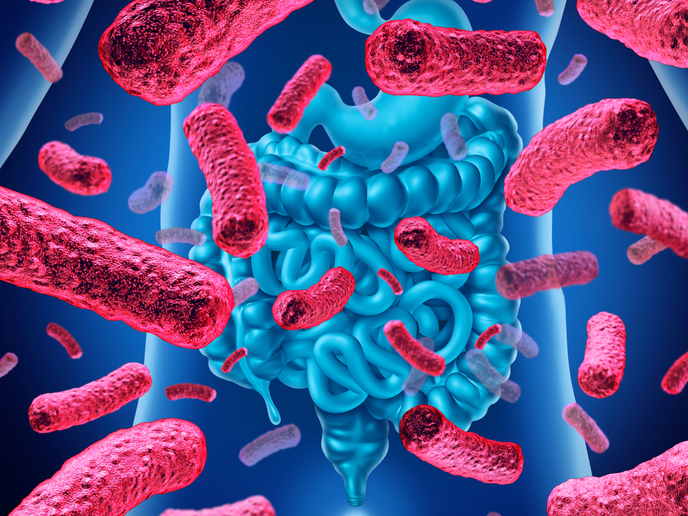Zusammenhang zwischen Darmflora und Darmgesundheit: Bakterien als Freund oder Feind
Mikrobiom und Darmepithel sind durch eine Barriere voneinander getrennt, die aus einer dichten, bakterienfreien inneren Schicht und einer äußeren Schleimschicht besteht. Hauptbestandteil der Schleimschicht ist das (mit mehr als 100 verschiedenen komplexen O-Glykan-Strukturen) stark glykosylierte Glykoprotein Mucin 2. O-Glykan-Strukturen sind Zuckerverbindungen, die an die Aminosäuren Serin und Threonin angehängt werden.
Einfluss mikrobieller Enzyme auf die Zusammensetzung der Darmschleimhaut
Einige Darmbakterien haben die Fähigkeit, Mucinglykane abzubauen und begünstigen so die Entwicklung chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen (CED) wie Colitis ulcerosa (UC), allerdings ist noch unklar, wie dieser Abbau genau stattfindet. Das über die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA) finanzierte Projekt MUC untersuchte daher, wie spezifische bakterielle Enzyme zum Mucinabbau beitragen. „Neue Erkenntnisse darüber, wie Darmbakterien die Mucinzusammensetzung im Darm verändern, könnten von großer medizinischer Bedeutung sein“, erläutert MSCA-Forschungsstipendiatin Ana Sofia Luis. Schwerpunkt der Forschungsarbeit war Bacteroides thetaiotaomicron (B. theta), ein Bakterium, das im Darm Polysaccharide aus Nahrungsmitteln und verschiedene endogene Glykane des Wirtsorganismus verstoffwechselt. Präklinische Untersuchungen an einem Tiermodell belegten einen Zusammenhang zwischen Sulfataseenzymen von B. theta und der Entstehung von Colitis ulcerosa. Die Forschungsgruppe untersuchte daher die Aktivität von 38 Enzymen (Sulfatasen und Glycosidhydrolasen), die den schrittweisen Abbau von O-Glykanen induzieren. Schwerpunkt der experimentellen Arbeit des Projekts war die Rolle spezifischer B. theta-Sulfatasen beim Mucinabbau, wobei Strukturanalysen bei einigen dieser Enzyme wichtige Einblicke zur Substratspezifität lieferten. Mittels mikrobiologischer Analysen sowie biochemischer Charakterisierung und Massenspektrometrie an komplexen O-Glykanen identifizierte Luis spezifische Enzyme, die die Anpassungsfähigkeit von B. theta bei der Darmbesiedlung fördern. Eine interessante Beobachtung dabei war, dass fast die Hälfte dieser Enzyme im Zusammenhang mit dem Mucinstoffwechsel steht.
Mikrobielle Enzyme als therapeutische Zielstrukturen
Zweifellos korreliert der Zustand der Schleimschicht im Magen-Darm-Trakt mit verschiedensten Krankheitsgeschehen und ist direkt und indirekt durch die bakterielle Aktivität im Darm beeinflussbar. Geraten Abbau und Neuproduktion der Schleimschicht aus dem Gleichgewicht, können Bakterien in das Epithel eindringen und Entzündungen verursachen. Das Projekt MUC identifizierte eine spezifische Sulfatase, die entscheidend die Verstoffwechslung von O-Glykan durch B. theta vorantreibt, was neue Erkenntnisse zur Modifizierung der Schleimschicht und die Verwertung von Mucin durch Darmbakterien lieferte. „Vor allem bieten unsere Forschungen neue Möglichkeiten für die Entwicklung spezifischer Inhibitoren für diese Sulfatase, um die bakterielle Aktivität und die Zerstörung der Schleimschicht im Darm zu verhindern“, erläutert Luis. Dies könnte die vor allem in Industrieländern zunehmende Inzidenz chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen und anderer Entzündungskrankheiten verringern. Schlüsselenzyme, die am Mucinabbau beteiligt sind, werden auch von anderen menschlichen Darmbakterien produziert, was Thema künftiger Forschungen sein wird. Die Komplexität der Mucin-Glykane deutet zudem auf eine koordinierte Enzymaktivität vieler anderer beteiligter Bakterien hin. So will Luis auch bei anderen Darmmikroben untersuchen, wie O-Glykane des Wirtes verstoffwechselt werden, und ob sich daraus ein Zusammenhang mit der Entstehung von CED ergibt.
Schlüsselbegriffe
MUC, Mucin, Darmflora, B. Theta, O-Glykan, Sulfatase, CED, UC, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Colitis ulcerosa